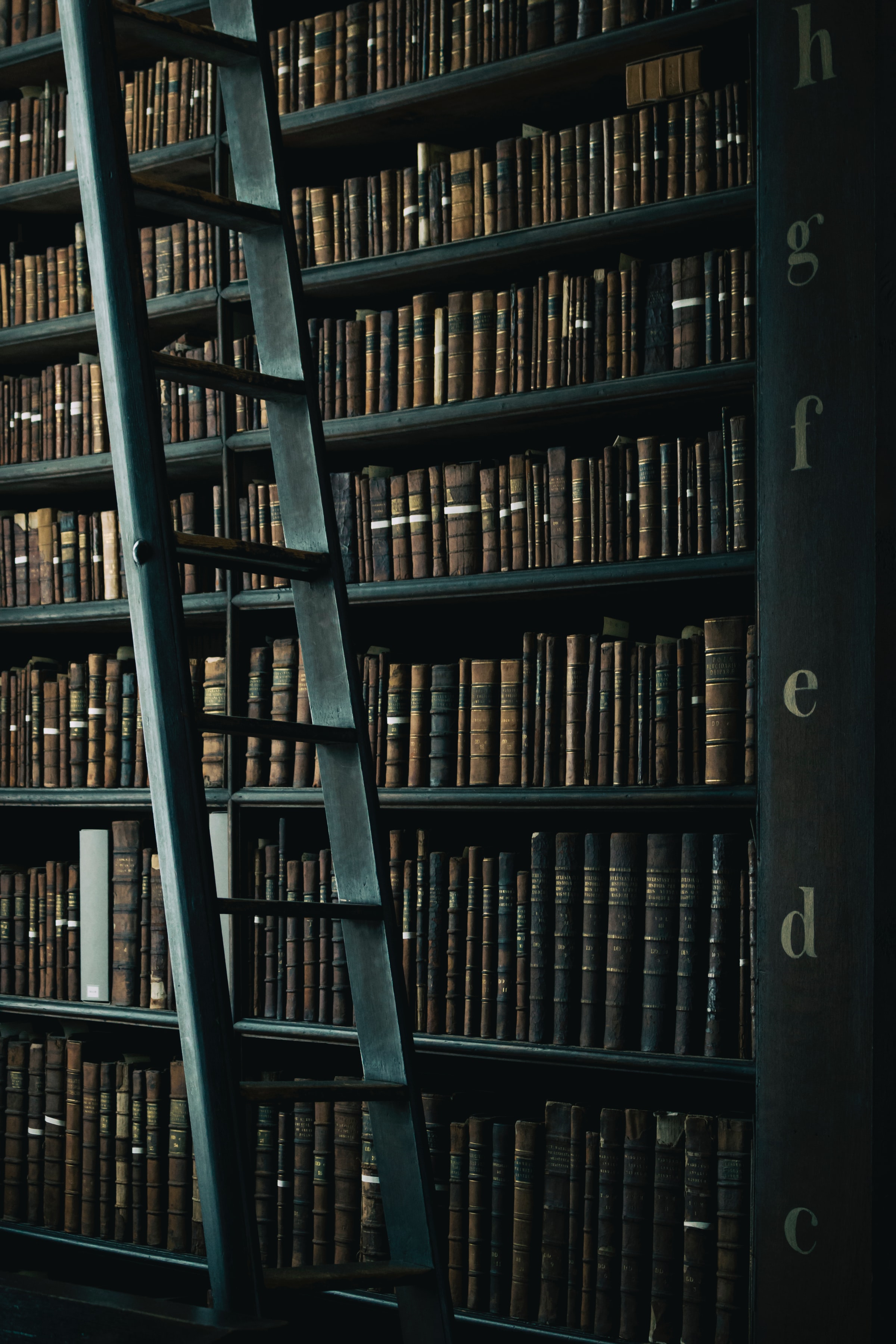Sommerzeit? Nein Danke!
Welche Vor- und Nachteile hat die Sommerzeit? Welche Auswirkungen hat die Umstellung?
Die Zeitumstellung intendiert in den Sommermonaten eine Anpassung des Lebensrhythmus an die Tageslichtzeit, so dass der Mensch einen größeren Teil seines Wachzustands bei Sonnenlicht verbringen und nutzen kann. So ist die Uhrzeit zum Sonnenaufgang im Hochsommer zum Beispiel nicht mehr gegen 4:00 Uhr Normalzeit, sondern etwa 5:00 Uhr Sommerzeit. Entsprechend verschiebt sich die Uhrzeit des Sonnenuntergangs von ungefähr 20:30 Uhr Normalzeit auf 21:30 Uhr Sommerzeit. In modernen Industrieländern richten sich die meisten Menschen in ihrem Tagesablauf eher nach der Uhrzeit als nach dem Sonnenstand; der Großteil der deutschen Bevölkerung schläft morgens um 4:00 Uhr noch, abends um 21:30 Uhr aber noch nicht. Deshalb stimmt die mit der Uhrzeit verbundene Wachphase der meisten Personen mehr mit der Tageslichtzeit überein. So sind auch Freizeitaktivitäten am Nachmittag und Abend länger bei Sonnenlicht sowie angenehmeren Außentemperaturen möglich, u. a. beim Breitensport.
Bei beruflichen Tätigkeiten, die draußen stattfinden, ist es zudem morgens z. B. an heißen Sommertagen noch eine Stunde länger kühl. Zum einen kann zwar abends das längere Tageslicht in Verbindung mit einer höheren Temperatur von Menschen, die zeitig zu Bett gehen müssen, als störend beim Einschlafen empfunden werden, zum anderen wird die Nachtruhe so jedoch nicht durch einen frühen Sonnenaufgang beeinträchtigt. Die Folgen einer fehlenden Anpassung verdeutlicht die Entwicklung in Russland, wo im Jahr 2011 zunächst die permanente Sommerzeit eingeführt wurde, 2014 aufgrund des späten Sonnenaufgangs im Winter allerdings eine Umstellung auf dauerhafte Normalzeit erfolgte. Seitdem werden im Sommer ein unnötiger Verlust von Tageslichtstunden am Abend und Schlafstörungen durch zu frühe Sonneneinstrahlung am Morgen beklagt.
Eine der offiziellen Begründungen für die Einführung der Sommerzeit war bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Einsparung von Energie (vor allem Beleuchtung). Dieses Argument war allerdings immer schon umstritten. Denn gegenüber anderen Einflüssen ist die Wirkung der Zeitverschiebung auf den Energieverbrauch zu vernachlässigen. Schon im Herbst 1916 wies ein Leiter eines kommunalen Energieunternehmens darauf hin, dass der Gasverbrauch nicht nur von der Sommerzeit abhängig sei, sondern ebenso von folgenden Faktoren: „Einschränkung der öffentlichen Beleuchtung, kühle und nasse Witterung, Rückgang des geschäftlichen Lebens, früherer Geschäftsschluss, Beschränkung der Industrie, schlechte wirtschaftliche Lage, Vereinfachung des Küchenbetriebes infolge der Lebensmittelverteuerung und des Mangels an langkochenden Lebensmitteln (Fleisch), Betriebseinschränkungen bei Bäckern und Fleischern, Verminderung des Fremdenverkehrs, Einführung von Münzgasmessern.“
Obwohl schon sehr früh klar war, dass die Sommerzeit keinen entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch nehmen konnte, hielt sich dieses Argument hartnäckig im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Doch insbesondere bei der Wiedereinführung der Sommerzeit in den mitteleuropäischen Ländern zwischen 1976 und 1981 spielte eine mögliche Energieeinsparung – wenn überhaupt – eine nur untergeordnete Rolle gegenüber dem Argument einer europaweiten Vereinheitlichung der Zeiten.
Befürworter der Sommerzeit argumentieren, dass sich die heutigen Lebensgewohnheiten geändert hätten. Daher sei es für viele Menschen vorteilhaft, abends länger bei Tageslicht die Freizeit gestalten zu können, wodurch ihre Produktivität erhöht werde. Kritiker führen an, dass bei der Zeitumstellung die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus mindestens mehrere Tage dauere, gesundheitsschädlich sei und während der Umstellungsphase die Produktivität verringere. Es lägen physiologische Studien vor, nach denen einige zirkadian schwankende Hormonspiegel, ähnlich dem des Stresshormons Kortisol, bis zu viereinhalb Monate brauchten, um sich vollständig den neuen Gegebenheiten anzupassen (wobei die Umstellung im Frühjahr mehr Probleme bereite). Ob allein diese Hormonspiegelschwankungen bereits krankheitsfördernd wirken, ist jedoch nicht belegt.
Alle Uhren müssen zweimal im Jahr umgestellt werden. Immer mehr Uhren werden heute über ein Funksignal (Funkuhr) automatisch gestellt, viele müssen aber insbesondere in Privathaushalten nach wie vor manuell umgestellt werden. Computeruhren können ebenfalls automatisch über eine Funktion des Betriebssystems gestellt werden. Allerdings gibt es Rechnerprogramme mit Echtzeitfunktion, die die Betriebssystemfunktion zur Sommerzeitumstellung nicht nutzen und manuell umkonfiguriert werden müssen. Das gleiche Problem gibt es auch bei Schaltsekunden.
Bei der Umstellung zunächst vergessene Uhren, zum Beispiel in Fotokameras, können später für Verwirrung sorgen. Problematisch können die Ereignisaufzeichnungen von solchen Uhren sein, die von einem autorisierten Personenkreis betreut werden, wenn die Umstellung erst einige Tage später vorgenommen wird und die gespeicherten Zeiten und darauf basierende Auswertungen somit falsch sind.
Mit der Sommerzeit wird eine – für ein bestimmtes Gebiet – gleichmäßig verlaufende Zeitskala aufgegeben und werden pro Jahr zwei Sprungstellen eingeführt. Im Frühling zum Zeitpunkt der ersten Umstellung pro Kalenderjahr (Annahme: Nordhalbkugel) fehlen in der gesetzlichen Zeitskala Koordinaten in einem Intervall von 60 Minuten. Bei der Rückstellung im Herbst finden sich Zeitkoordinaten eines ebensolangen Intervalls doppelt. Die Skala wird also uneindeutig, sie hat arithmetisch eine Lücke und eine Überlappung.
So bedarf es zur bloßen Zeitangabe in Mitteleuropa z. B. 28. Oktober 2018, 2:33 Uhr zusätzlich der Angabe, auf welche Skala sich die Zeitkoordinate bezieht: MEZ oder MESZ. Das bedeutet zusätzlichen Programmier- und Rechenaufwand und eine mögliche Fehlerquelle. Zum Bestimmen der Umstellungstage ist die Wochentagsberechnung zur Ermittlung der monatsletzten Sonntage im März und Oktober nötig.
Bayerischer Rundfunk | 28.10.2019
Quarks | 01.04.2019
tagesschau | 17.08.2016
maiLab | 27.10.2019